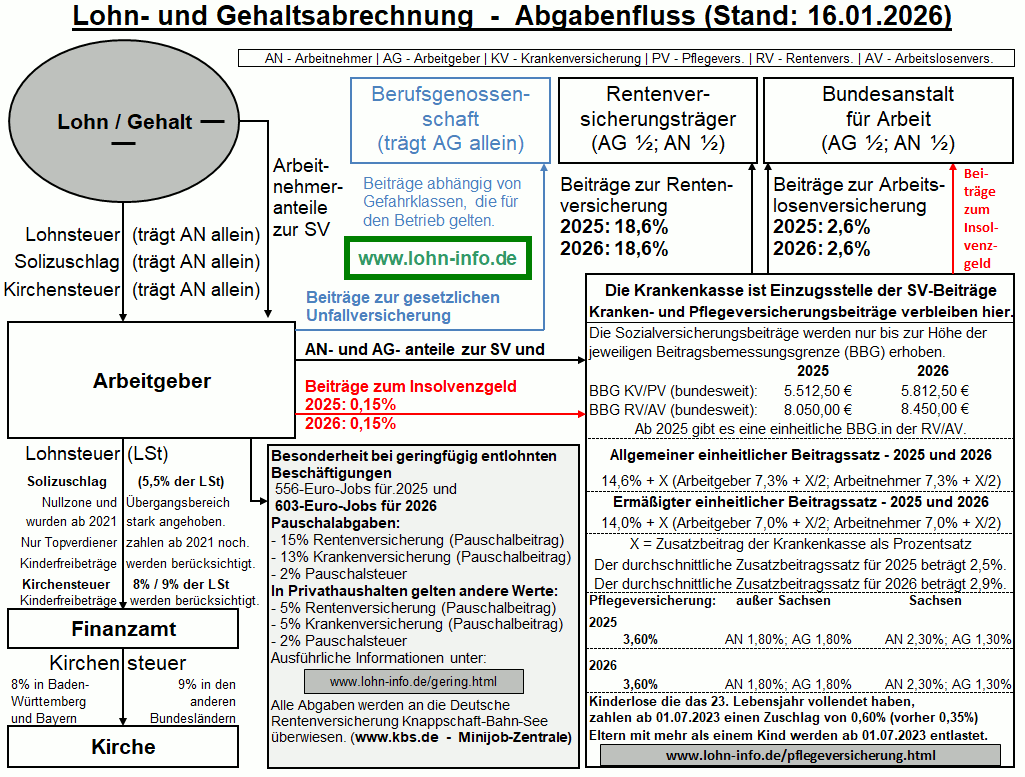Grundlagen der Lohn- und Gehaltsabrechnung - Abgabenfluss
Hier erhalten Sie einen Überblick, wohin die wichtigsten Zahlungen nach einer Lohnabrechnung gehen.
In dem folgenden Schema können nicht alle Besonderheiten abgedeckt werden. Es geht um grundsätzliche Zusammenhänge.
Die Grafik als PDF-Dokument zum ausdrucken.
Der Arbeitgeber hat im Prozess der Lohnabrechnung zentrale Aufgaben. Diese wird er selten selber erledigen sondern an einen Steuerberater oder einen Mitarbeiter in der Buchhaltung bzw. Lohnbuchhaltung delegieren. Trotzdem bleibt er laut den geltenden Rechtsgrundlagen die Verantwortliche und Haftende Person.
Wie aus dem Schema ersichtlich gibt es vier Stellen wohin Beträge fließen:
- Berufsgenossenschaft
Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung hat der Arbeitgeber allein aufzubringen und an die zuständige Berufsgenossenschaft abzuführen. Dies gilt auch für geringfügig entlohnte Beschäftigungen.
Ausnahme: Seit dem 01.01.2006 übernimmt die Minijob-Zentrale bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen in Privathaushalten die Anmeldung zur gesetzlichen Unfallversicherung und den Einzug der Unfallversicherungsbeiträge. - Einzugsstelle der Krankenkasse
- Die Beiträge zu den vier Sozialversicherungszweigen gehen an die Einzugsstelle der Krankenkasse des Arbeitnehmers (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile).
Dies gilt nicht für geringfügig entlohnte Beschäftigungen.
Mit der Weiterleitung der Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung hat der Arbeitgeber nichts zu tun. - Der Beitrag zum Insolvenzgeld ist ab 2009 mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die Einzugsstellen der Krankenkassen
zu überweisen. Es wird nicht mehr jährlich nachträglich gezahlt, sondern monatlich. Bis 2008 wurden die Beiträge von den Berufsgenossenschaften erhoben.
Der Beitragssatz wird von den Arbeitgebern allein finanziert.
Die Insolvenzgeldumlage wurde zum 01.01.2023 von 0,09 Prozent auf 0,06 Prozent gesenkt (Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2023).
Die Insolvenzgeldumlage für das Kalenderjahr 2024 bleibt bei 0,06% (Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2024).
Die Insolvenzgeldumlage beträgt 0,15 Prozent ab dem 1. Januar 2025. Damit gilt ab dem 1. Januar 2025 wieder der in § 360 SGB III festgelegte Wert für die Insolvenzgeldumlage.
Mit der Weiterleitung der Beiträge hat der Arbeitgeber nichts zu tun.
- Die Beiträge zu den vier Sozialversicherungszweigen gehen an die Einzugsstelle der Krankenkasse des Arbeitnehmers (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile).
Dies gilt nicht für geringfügig entlohnte Beschäftigungen.
- Minijob-Zentrale
Für geringfügig entlohnte Beschäftigungen gelten die entsprechenden Pauschalabgaben von 15% Rentenversicherung, 13% Krankenversicherung und 2% Pauschalsteuer. Alle Beträge werden grundsätzlich an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Minijob-Zentrale) abgeführt.
Ab dem 1. Oktober 2022 orientiert sich die Geringfügigkeitsgrenze an einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Die Minijob-Grenze wird damit eine dynamische Grenze, die bei einer Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns steigt.
Bei dem ab 1. Oktober 2022 geltenden Mindestlohn von 12 Euro ergeben sich 520 Euro als Geringfügigkeitsgrenze (520-Euro-Job).
Bei dem für 2024 gültigen Mindestlohn von 12,41 Euro ergibt sich eine Geringfügigkeitsgrenze von 538 Euro (538-Euro-Job).
Bei dem ab 01.01.2025 gültigen Mindestlohn von 12,82 Euro ergibt sich eine Geringfügigkeitsgrenze von 556 Euro (556-Euro-Job).
Bei dem ab 01.01.2026 gültigen Mindestlohn von 13,90 Euro ergibt sich eine Geringfügigkeitsgrenze von 603 Euro (603-Euro-Job).
Bei dem ab 01.01.2027 gültigen Mindestlohn von 14,60 Euro ergibt sich eine Geringfügigkeitsgrenze von 633 Euro (633-Euro-Job). - Finanzamt
Alle Steuerbeträge für Arbeitnehmer gehen an das zuständige Finanzamt (außer die 2% Pauschalsteuer für geringfügig entlohnte Beschäftigungen).
Mit der Weiterleitung der Kirchensteuer hat der Arbeitgeber nichts zu tun.
Am 01.01.2009 erfolgte die Einführung des einheitlichen Beitragssatzes (allgemein und ermäßigt) in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Sonderbeitrag in Höhe von 0,9% ging ab 2009 im einheitlichen Beitragssatz auf. Der erhöhte Beitragssatz ist zum 01.01.2009 weggefallen. Ab diesem Zeitpunkt besteht die Pflicht zur Krankenversicherung für alle.
Mit Wirkung ab 01.01.2015 wurde der allgemeine Beitragssatz für die Gesetzlichen Krankenkassen bei 14,6 Prozent festgeschrieben. Brauchen die Kassen mehr Geld, können sie einkommensabhängige Zusatzbeiträge erheben.
Damit gibt es eine verbindliche Beitragsuntergrenze von 14,6 Prozent beim allgemeinen Beitragssatz (Arbeitnehmer und Arbeitgeber je 7,3 Prozent).
Beim besonderen Beitragssatz gibt es eine verbindliche Beitragsuntergrenze von 14,0 Prozent (Arbeitnehmer und Arbeitgeber je 7,0 Prozent).
Übersicht der Sozialversicherungsbeiträge 2025
Übersicht der Sozialversicherungsbeiträge 2026
Mit dem Versichertenentlastungsgesetz werden die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung ab 1. Januar 2019 wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Versicherten getragen. Der bisherige Zusatzbeitrag wird damit paritätisch finanziert. Für die Finanzreserven der Krankenkassen werden gesetzlich definierte Höchstgrenzen vorgesehen und Abbaumechanismen geschaffen, damit überschüssige Mittel der Gesundheitsversorgung zugeführt und die Zusatzbeiträge stabilisiert bzw. abgesenkt werden können.
Bei einer Beschäftigung innerhalb der Grenzen des Übergangsbereich (früher Gleitzone) besteht für den ausübenden Arbeitnehmer in allen Zweigen der Sozialversicherung grundsätzlich
Versicherungspflicht nach den allgemeinen Vorschriften. Die in den einzelnen Sozialversicherungszweigen geltenden versicherungsrechtlichen Regelungen finden uneingeschränkt Anwendung.
Die in diesem Entgeltbereich Beschäftigten (Midijobs) bleiben damit versicherungspflichtig, der Arbeitnehmer zahlt allerdings einen reduzierten Beitragsanteil in der Sozialversicherung. Diese Besonderheit wurde oben
nicht dargestellt.
Im Schema ebenfalls nicht dargestellt sind die Umlagen zur Entgeltfortzahlungsversicherung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG).
Für alle Betriebe gilt seit dem 01.01.2006 die Pflicht zur Teilnahme am Umlageverfahren U2 (Mutterschaft).
Für Betriebe mit bis zu 30 Arbeitnehmern gibt es zusätzlich die Pflicht zur Teilnahme am Umlageverfahren U1 (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall).
© 2007-2026 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon